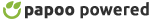Tracht in Oberbieber
Ein genauerer Blick auf die Frage: Gibt es eine typische Tracht eigentlich nur woanders – oder vielleicht sogar auch bei uns in Oberbieber?
In den letzten Jahren hat in Deutschland und Österreich die Tracht und damit zusammenhängend auch die Trachtenmode einen Aufschwung erlebt. Globalisierung, Wirtschaftskrise und die mit diesen Entwicklungen zusammenhängende oder ihnen entgegengesetzte Rückbesinnung auf traditionelle Werte und altes Kulturgut wird für diese Entwicklung als ursächlich angesehen, wie auch der Artikel zur Tracht im Internet-Lexikon Wikipedia feststellt. Traditionelle Bekleidung wird zusehends von vielen Menschen in die heutige Lebenswelt integriert. Allerdings hat man, wenn von „Tracht“ gesprochen wird, vor dem geistigen Auge stets die bayerisch-alpenländische Gebirgstracht mit kurzen Lederhosen und Dirndlkleid vor Augen, die so direkt natürlich ihre Heimat am Rhein, Wied und Aubach nicht hat. Zunehmend stellen sich Menschen die Frage, ob man eigentlich tatsächlich immer so angezogen sein muss, als käme die eigenen Kleidung gerade frisch vom Mars oder aus der Kunststofffabrik.
Was meinen wir eigentlich mit dem Begriff „Tracht“?
Als Definition des Begriffs „Tracht“ (von althochdt. traht(a), mittelniederdeutsch dracht: das, was getragen wird) setzt das Internet-Lexikon fest, dass der Begriff im „Allgemeinen für traditionelle und historische Kleidung oder Teile davon gebraucht“ wird: „Die Tracht ist die traditionelle Kleiderordnung einer bestimmten Region, eines Standes oder der Angehörigen einzelner Bevölkerungsgruppen, z. B. Ethnien (Volksgruppe) oder Berufsgruppen.“ Trachten sind das Ergebnis langwieriger Entwicklungen. Die Beschreibung von „Wikipedia“, dass traditionelle Kleidung in vielen Teilen der Welt im Zuge der auch kulturellen und modischen Globalisierung im Alltag bereits weitgehend zurückgedrängt wurde, trifft für unsere Region schon seit langem zu: Als das Interesse an Trachten in vielen Regionen in Deutschland im späten 19. Jahrhundert erwachte, als man sich im Zuge der Heimatbewegung auf regionale Besonderheiten und die (in dieser Form sicher nie existent gewesene) ländliche Romantik besann, war zwar auch für den Richter und Dichter Leo Sternberg bei einer von ihm 1911 herausgegebenen Sammlung von Texten über den Westerwald das Thema der Tracht fest mit der Gesamtbeschreibung der Region verbunden. Aber der Autor schreibt bereits 1911 bei der Beschreibung der Tracht in der Vergangenheitsform. Auch zu seiner Zeit sind viele traditionelle Besonderheiten bereits verschwunden.
Eines jedoch stimmt in der Radikalität definitiv nicht ganz: Der verdiente Historiker Hermann Josef Roth meinte in einer Veranstaltung zum Thema „Westerwald“ (Bericht unter http://www.ak-kurier.de/akkurier/www/artikel/6731-literaturtage-- was-ist-eigentlich-der-westerwald- vom 26.9.2009) aufklären zu müssen: es habe niemals eine Westerwälder Tracht gegeben. Vielmehr seien die Kniebundhosen und die Jacke "Ausdruck der Armseligkeit". Er wird zitiert: „Neues, resümiert Roth, war im Westerwald nicht an der Tagesordnung. Geld war nicht genügend vorhanden, "und so wurden die alten Klamotten vom Großvater noch aufgetragen." Später regelte dann der Volksmund das Geschehen. Da war dann die "Tracht" entstanden, die es eigentlich nie gab. In der Tat sind streng genommen viele Elemente der Kleidung, die heute bei manchen Vereinen als „Wäller Tracht“ bezeichnet wird, einfache allgemeine Elemente der Kleidung, die in zahlreichen Regionen in Mitteleuropa in vielen Berufsgruppen und Gegenden von den Menschen getragen wurde und besitzt nur wenige Alleinstellungsmerkmale gerade einer bestimmten Region. Diese Grundformen wurden dann per Entscheidung auf einen bestimmten Ort oder zumindest die Region Westerwald („Wäller“-Tracht) bezogen.
Und das nicht zu Unrecht. Denn: Es gab eben doch eine „Tracht“, wenn man diesen Begriff so definiert wie eingangs beschrieben. Dann geht es nämlich bei der Frage „Gibt es eine Tracht?“ darum, ob es eine bestimmte Kleidung gibt, die typisch von alters her von den Menschen in unserer Region getragen wurde. Und dies muss mit „Ja“ beantwortet werden. Wegen der räumlichen Nähe zur Wiedischen Residenzstadt Neuwied hat sich allerdings eher städtische Mode und Bekleidung schnell durchsetzen können. Daher wird diese althergebrachte Kleidung heute bei uns nicht, wie an anderen Orten, wenigstens noch als Festtagstracht getragen, und auch im Alltag finden sich traditionelle Kleidungsstücke heute nicht mehr bewusst. Meint man. Denn bei genauerem Hinsehen sieht es denn doch mitunter deutlich anders aus.
Beispiele noch getragener traditioneller Kleidung
So werden natürlich nach wie vor komplette oder teilweise Berufs- oder Vereinstrachten getragen. Kaminkehrer, Uniformen der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben wie Polizei und Feuerwehr, Die „Ahle“ und der Scholdes der Burschen, die Pfadfinder tragen aktuell fest beschriebene Kleidung, die nicht allein als Funktionskleidung bezeichnet werden kann und die sich auch nicht saisonal kurzfristig wandelt wie andere, der Mode oder anderen schnelllebigen Entwicklungen unterworfene Kleidung.
Sind „alpenländische“ Kleidungsstücke in unserer Region akzeptabel?
Auch die sonst eher mit den Gebirgsregionen verortete und als „alpenländisch“ bezeichnete Tracht ist nicht allein und ausschließlich eine Sache der Alpenländer. Da viele Elemente der als alpenländisch zu bezeichnenden Trachten ihren Ursprung in der Jagd- und Forstkleidung haben, stellt sich die Frage nach der Verbindung in unsere Region. Und hierzu muss man feststellen: Die Jagd und das Forstwesen haben seit jeher auch in und um Oberbieber eine große Bedeutung, auch wenn sie im Alltag von breiten Bevölkerungsschichten heute nicht oder nur kaum wahrgenommen werden. Ein deutliches Beispiel für die in unserer Region verwendete Jagdbekleidung weist die klare Orientierung an den Formen nach, die man als „alpenländisch“ bezeichnet: Ein Gemälde einer Jagdszene im Buchbachtal von Fritz von Wille aus dem Jahre 1892 (Dauerleihgabe an das Neuwieder Roentgen-Museum aus Privatbesitz). Abgebildet sind laut Beschreibung Neuwieder Fabrikanten und Verleger als Jagdgesellschaft. Ein Bezug dazu ist in unserer Region erwiesenermaßen zu Hause (auch bereits bewusst angewandte frühe alpenländische Bauform etwa beim fürstlich wiedischen „Meinhof“ oberhalb des Wiedtales und diversen anderen). Ferner werden Jungen – nachgewiesen auf Fotografien – spätestens ab den 30er Jahren in kurzen Lederhosen im alpenländischen Stil und mit Hirtenhut bekleidet; auch in den 70er Jahren war dies durchaus als praktische, unverwüstliche Alltagshose üblich, wie der Autor dieser Zeilen aus eigener Erfahrung und Anschauung berichten kann. Somit gilt letztlich als Antwort auf die Frage der obenstehenden Abschnittsüberschrift: Ja, viele Elemente davon haben sogar ihr Zuhause auch bei uns. Das bedeutet allerdings nicht, dass alle „Oktoberfest-Outfits“ etwas mit historischer Tracht unserer Region zu tun haben – sie haben ja meist auch noch nicht einmal mit bayerischer Tracht zu tun, sondern sind reine Fantasieprodukte auf Basis bestimmter Muster.
Erhaltene historische Trachtenstücke
Tatsächlich kann man fündig werden, wenn man gezielt Informationen über die historische Tracht unserer Region sucht. Etwa im heutigen Roentgen-Museum, dem Kreismuseum in Neuwied. Hier finden sich in der Ausstellung der Heimatstuben nicht nur Stücke historischer Täuflingshauben, sondern auch die Hauben weiblicher Tracht aus unserer näheren Umgebung, leider nicht direkt aus Oberbieber, aber aus direkten Nachbarorten. Ferner sind hier mehrere Stücke der sogenannten „Tugendpfeile“ ausgestellt, breite Haarnadeln, die speziell in der mittelrheinischen Region zu Hause sind und ein spezifisches regionales Bekleidungsmerkmal sind, wenn auch aus Orten mit Bevölkerung überwiegend konfessionell katholisch geprägter Bevölkerung. Zur Sammlung gehört auch ein „Blaukittel“. Fest steht: Oberbieber gehört, anders als die Nachbarn des Kirchspiels Engers, zum protestantisch geprägten Gebiet. Die Bekleidungen sind damit dort generell schlichter und in unauffälligeren Farben gehalten gewesen als in den katholisch geprägten Teilen unserer Region. Bis heute erhalten hat sich die bei bestimmten Anlässen auch heute noch getragenen Tracht der Herrnhuter Brüdergemeine, die einen Eindruck davon vermittelt, wie die Elemente barocker Bekleidung sich im nichtkatholischen Bereich darstellte. Auch hier ist ein Einfluss durchaus nicht abwegig, denn Herrnhuter waren in Oberbieber durchaus präsent. Das beweist der Altbau der evangelischen Kinder- und Jugendhilfe, der aus zwei historische Mühlengebäude besteht. Diese wurden von Herrnhutern erbaut und betrieben.
Eine genauere Beschreibung wiedischer Tracht
Die Beschreibung von Otto Stückrath bei Leo Sternberg von 1911 über die Tracht in den wiedischen Gebieten zählt auf: Die räumlich ziemlich weit getrennten ehemals fürstlich Wiedischen Gebiete gehören ihrer Tracht nach zusammen. Die Übereinstimmung in beiden Landesteilen – dem Bezirk Selters im westlichen und dem Bezirk Runkel im östlichen Westerwald – ist also eine durch die politischen Verhältnisse bedingte. Der Bauer trug Kniehosen, „kurze Buxe“, für den Alltag aus blauer, für den Feiertag aus weißer Leinwand. Auch solche aus gelblichem Hischleder wurden an Feiertagen gesehen. Die ursprünglich beiderseits offenen, durch dicht aneinander gereihte Steinknöpfe geschlossenen gamaschenartigen Beinlinge wurden später durch solche mit Naht ersetzt. Sie gingen bis in die halben Waden und wurden von den grauen oder schwarzen Strümpfen, die man am oberen Rande umschlug, bis zu den Knien bedeckt. Lederhosen gingen bis knapp unter das Knie; eine Metallschnalle mit Riemchen schloss sie. Werktags waren glatte Strümpfe von hellem „Müllerblau“ oder weißer und grauer Farbe beliebt. Die Riemenknöchelschuhe trugen eine große Messingschnalle als Schmuckstück. Die schwarze oder schwarzblaue, mit Stehbrust und Umlegekragen oder ohne diesen, durch eine Reihe weißer Knöpfe verschließbare Weste erhielt am oberen Ende ihren Abschluss durch das scharze Halstuch, das unter dem umgebogenen Hemdkragen durchgezogen und vorn verknotet wurde. Über der Weste saß das gerade abfallende, mit halbliegendem Kragen, kurzen Brustklappen und deckellosen Seitentaschen ausgestattete, bald mit zwei Reihen Knöpfen besetzte, bald knopflose Kamisol, das für die Werktage aus blauem Leinen, für die Feiertage aus schwarzem Tuch verfertigt war. Das „Staatskamisol“ war aus lilabräunlichem Garn gestrickt, ging mit leicht eingezogener Taille bis zum halben Oberschenkel herunter, hatte enganliegende Ärmel, einen Stehkragen und an den Brustkanten herunter auf einer Seite eine Reihe Knöpfe, auf der anderen entsprechende Knöpfschnüre. Recht selten sah man den blauen Kittel. Bis zu den Kniekehlen reichte der schwarze oder schwarzblaue Tuchrock mit Umlegekragen und stattlichen, nach unten spitz verlaufenden Brustklappen, unter denen sich vier große, schwarz übersponnene, tellerförmige Knöpfe bargen, denen nur drei Knopflöcher entsprachen. Die werktägige Kopfbedeckung war die Bambelmütze. Ihr folgte die Schildkappe. Sonntags trug man den rundkopfigen, breitrandigen Hut, daneben aber auch die Kappe oder den Zylinder.
Der weibliche Anzug hatte typische Unterscheidungsmerkmale nur in der Schürze, im Brusttuch und im Kopfputz. Die mit Rieselfalten versehenen grieseligen Barm- oder hochroten Büffelröcke wiesen Besonderes nicht auf. Auch das braune, dunkel- und hellblaue Mieder, die „Motze“, ähnelte den schon beschriebenen Leibchen. Es treten neben den Strümpfen aus Naturwolle auch solche aus blau- oder schwarzgefärbter Wolle auf. Zur Kommunion und zum Begräbnis ging man in schwarzen Strümpfen. Das Brusttuch war ein großes, schweres Tuch von beliebiger Farbe, mit blumigen Ornamenten bedruckt, am Rande mit Fransen verbrämt. Für Feiertage liebte man das schwarzseidene, in einer Ecke mit einem kräftigen Rosenmuster versehene Brusttuch. Es wurde ins Dreieck gelegt, dann noch zweimal von der Bruchfalte aus auf sich selbst bandartig zusammengefaltet, vom Nacken her so angelegt, dass der Ornamentschmuck auf den Rücken zu liegen kam, auf der Brust gekreuzt und über der Taille mit Nadeln festgeheftet oder auf dem Rücken mit den freien Zipfeln verknotet. Die bundlose Schürze ging Werktags um die Hüften herum und schloss hinten fast völlig. Sie bestand aus blauem Leinen. Die Sonntagsschürze, aus blauem, mit bunten Blümchen bedrucktem Kaschmir – manchmal auch aus Seide – verfertigt, war schmal und deckte nur die Vorderseite des Körpers ab. Die ältere Form der Frisur war der „Schnatz“. Bei gebeugtem Kopfe kämmte man das Haar von hinten nach vorn nach dem Scheitel herauf, band es dicht am Kopfe mit einem Bande zusammen und durchstach es unter dem Bande mit einem fingerlangen Pfeile. Dann teilte man die Haarquaste in zwei Strähne, die man entweder flocht oder nur zusammendrehte und dann unter der Nadel her zu einem Kranze zusammenlegte, der mit Haarnadeln noch besonders befestigt wurde. Abgelöst wurde der „Schnatz“ durch die „Haarrank“, bei der man das Haar glatt nach dem Wirbel strich, die ganze Haarmasse dicht am Kopf mit einem Bande zusammenheftete und dann breit ausladend über den Nacken hinab und von hier aus wieder in die Höhe schlug, sie auf dem Hinterkopf mit Nadeln oder einem kleinen Kamm befestigend. Auf das Haar kam zuerst eine Futterhaube, die von der eigentlichen Haube, dem „Kommodchen“, bedeckt war. Frauen trugen Hauben aus schwarzer Seide, Mädchen solche aus dunkelfarbigem Kattun mit vergissmeinnicht-blauen Blümchen bedruckt. Bei festlichen Gelegenheiten zog man eine Haube aus feinem weißen Mull über die dunkelfarbige.
Verwandte Tracht zum Anschauen
Dieser der alten Bekleidungssitten zeitlich ja noch recht nahen Schilderung sehr ähnliche Beschreibungen der hessischen „Ländches-Tracht“ aus einer der unseren recht naheliegenden Region mit Fotos finden sich im Internet unter der Adresse https://trachtenland-hessen.de/trachten/landchestracht. So kann man sich die beschriebene Tracht in der Ansicht wohl vorstellen, wenn auch einige Details vielleicht nicht genau übereinstimmen. Die Beschreibung von 1911 hält recht umfangreich die historische Tracht der Region fest. Jedoch hatte sich zur Zeit des Abfassens der Beschreibung bereits zumindest im Alltag eine Weiterentwicklung ergeben.
Traditionelle Kleidung – Rückschlüsse für Oberbieber
Was ist der kleinste gemeinsame Nenner? Bei der Antwort nach der Frage nach einer Tracht unserer Region kann es also nicht, wie es sich in den süddeutschen Trachtler-Gegenden mit ihren entsprechenden Vereinen entwickelt hat, um eine „Tracht-Uniform“ gehen, die für alle Träger exakte und zwingende Vorgaben der Ausstattung und Trageweise macht. Solch eine uniforme Tracht könnte höchstens in einem Verein zu Hause sein, der sich einer solchen Entwicklung verschrieben hätte und einen Stereotyp pflegen möchte. Die tatsächliche Vergangenheit der regionalen Tracht liegt aber ganz sicher in der weitgehend zwar ähnlichen, aber individuellen Ausstattung der Kleidungsträger, orientiert am einst Üblichen, Zweckmäßigen, Erhältlichen und Bezahlbaren. Hierzu kann man, gegründet auf den zugänglichen Fotografien der Zeit vor und um den 1. Weltkrieg folgendes als kleinstem gemeinsamen Nenner zusammenfassen:
Männer trugen grundsätzlich Hemd (Schlupfhemd), feiertags in Weiß, mit Weste (dunkel) und Überjacke (dunkle Farbe), lange dunkle Hose sowie Kopfbedeckung (Schirmmütze, Hut) und einfachem Schuhwerk (feiertags grundsätzlich schwarz). In der heißen Jahreszeit sind auch Strohhüte zu beobachten. Vereinzelt hat auch der berühmte Blaukittel, vor allem im Alltag, seine Dienste geleistet; eine Fotografie einer Gruppe aus drei Oberbieberer Handwerkerfamilien vom Ende des 19. Jahrhunderts zeigt zwei der Männer tatsächlich im Kittel, drei mit „Schildmütze“ ( = Schirmmütze) – hier werden diese Bekleidungselemente offensichtlich als feine Ausflugskleidung getragen, nicht als Arbeitsanzug.
Zahlreiche Arbeitsjacken waren aus „Blauzeug“ gefertigt. Der Müllerbursche auf einer Aufnahme der Jahrhundertwende vor der Mühle Weinzheimer zeigt diesen mit einer hellen Kittel-Version und Schildmütze, der Bauer Wilhelm Klappert auf dem Fotopositiv auf Rasselsteiner Blech von 1885 trägt ebenfalls Blaukittel und Schildmütze. Die Verbreitung des Kittels ließ vor rund 100 Jahren deutlich nach; zumindest berichtet Franz Jostes 1904 in seinem westfälischen Trachtenbuch, das "heutzutage der Blaukittel nur noch von Hausierern, Metzgern und andren Leuten, die viel unterwegs sind, getragen wird“, und auch Otto Stückrath schreibt ja, dass der Kittel 1911 nur selten im Wiedischen Land anzutreffen gewesen sei. Der Bauer kleide sich zwar noch in das bequeme blauleinene Wams, aber die Kniehosen seien dahingegangen. Die Stadt liefere billige Arbeitshosen aus „allerhand“ Stoff. Die Bäuerin kenne nicht Haube und Kommodchen mehr, wohl aber den städtischen Hut, die Bluse und – wenn’s erst noch ein Weilchen gedauert hat – auch das Reformkleid. Der Autor hatte eben den Siegeszug der Jeanshose noch nicht erleben können.
Frauen trugen lange Haare niemals offen, sondern stets zusammengelegt (Flechtfrisuren oder Knoten, sicherlich wie in der Beschreibung von 1911 erklärt), auch bedeckt durch Häubchen im Hinterkopfbereich oder Kopftücher, letztere bei der Feldarbeit oftmals aus weißem Stoff/Leinen. Über einer Bluse, durchaus auch einem Mieder, wurde die kurze Jacke, die Mutzen oder Motzen, getragen. Auf den Fotos sind die Blusen stets züchtig hochgeschlossen, eine andere Trageweise wäre damals nicht infrage gekommen. Lange Röcke waren Standard, die stets mit Schürzen geschützt wurden. Für Witwen und zu Trauerzeiten war die Kleidung grundsätzlich in Schwarz gehalten.
Wie sich junge Oberbieberer Mädchen „offiziell“ Ende des 19. Jahrhunderts kleideten, ist gut auf einer Fotografie der Zeit um 1876 einer Mädchen-Schulklasse mit Lehrer Breitenbach zu sehen. Hier wird auch klar, dass es keine einheitliche Farb- oder Mustervorgabe gab, sondern eine große Vielfalt. Zur Arbeit waren viele Kleidungselemente, insbesondere die Schürzen, auch aus „Blauzeug“, dem klassischen, durch das „Blaumachen“ gefärbten Arbeitskleidungsmaterial, gefertigt.
Eines bleibt festzuhalten: Es ist unzutreffend zu behaupten, es habe in Oberbieber Tracht nicht gegeben. Diese Aussage beweist ein zu enges Verständnis des Begriffes „Tracht“. Eine andere Frage ist es, aus welchen Gründen sich ein bestimmtes „Outfit“, ergab. Armut und Einfachheit sind nicht die schlechtesten Gründe für eine bestimmte Kleidung, auch wenn barocker Reichtum und Schmuck für die meisten Menschen am Aubach nie so maßgeblich sein konnten wie möglicherweise andernorts.
Begriffsgeschichte und Trachtenentwicklung
Die Trachtenbücher des 16. Jh. machen auch deutlich, daß die Kleidung je nach Region und sozialer Schicht unterschiedlich war. Das ist nicht weiter erstaunlich, wenn man bedenkt, daß der Normalbürger selten über den nächstgrößeren Marktort hinauskam, weil er zu Fuß gehen mußte: Postkutschen verbanden nur größere Orte und kosteten Geld; die heimische Arbeit für mehr als eine Tagesreise zu verlassen, war nur den wenigsten möglich – und auch dann meist nur, um Waren zum Markt zu bringen. Es gab keine Zeitschriften, die Informationen zum Normbalbürger hin gebracht hätten, und der größte Teil der Bevölkerung hätte sie auch gar nicht lesen können. Neue Impulse für die Mode erreichten einen beliebigen Ort also nur auf drei Wegen: Durch ortsansässige Adlige und reiche Bürger, die auch mal in die Weite Welt reisen konnten und von dort fremdländische Moden mitbrachten, durch Reisende (wiederum eher reiche Leute oder Händler), oder durch Besuch im Nachbarort bzw. aus demselben.
Bei jeder dieser Berührungen werden jeweils nur einzelne Merkmale übernommen: Eine Kragenform, eine Verzierung, die Rocklänge... Dasjenige Merkmal, das sich die Modeführer des jeweiligen Ortes aneignen, hat die größte Chance darauf, von den anderen Einwohnern übernommen und der existierenden Tracht hinzugefügt zu werden. Und das ist möglicherweise in jedem Ort ein anderes Merkmal, je nach Geschmack der jeweiligen Modeführer. Die informationelle Isoliertheit des "gemeinen Volkes", das im Normalfall nur so weit reisen konnte, wie die eigenen Füße trugen, im Verein mit dem individuellen Geschmack der Meinungsführer, kann die regionalem Unterschiede in der Kleidung erklären, die bei größerer Entfernung eher größer sind, bei geringerer eher klein.
Je größer eine Ortschaft und je näher sie an einer Residenzstadt ist, desto eher ist die Bevölkerung Einflüssen von außen – über den in der Residenzstadt wohnenden Adel und dessen Besucher auch aus dem Ausland – ausgesetzt. Das ist wohl auch der Grund, warum die Trachten größerer Städte im 18. Jh. zwar im Detail verschieden, aber im Großen und Ganzen ähnlich sind. Auch das läßt sich an Trachtenbüchern nachvollziehen, die im frühen 18. Jh. eine zweite Blüte erlebten3, nun aber meist die Tracht jeweils genau einer Stadt (z.B. Augsburg, Ulm, Straßburg4) zeigten. Wie die Memoiren Casanovas belegen, reisten in dieser Zeit relativen Friendens viele angehörige der müßigen Klasse, aber auch Künstler kreuz und quer durch Europa, von einer Residenzstadt zur nächsten. So sind die Trachten der Stadtbürgerinnen Süddeutschlands im 18. Jh. einander in den wesentlichen Punkten sehr ähnlich, ähneln aber auch denen der Bürgerinnen anderer europäischer Städte.
http://www.marquise.de/de/ethno/bayern/tracht.shtml
Autor: Frank Hachemer